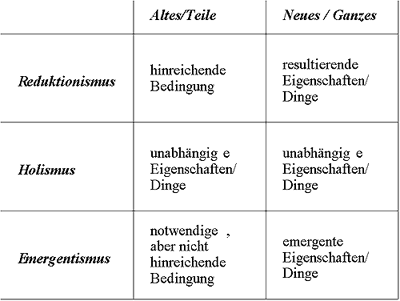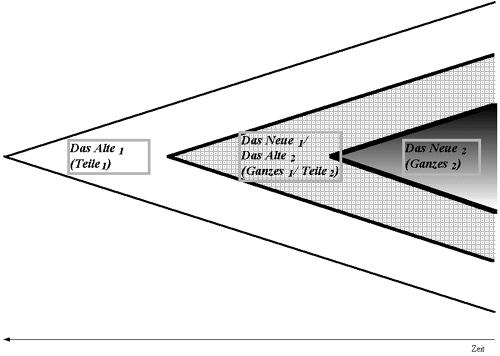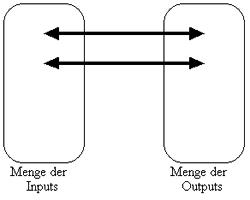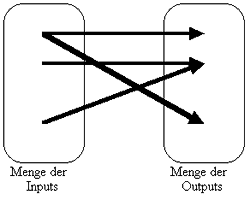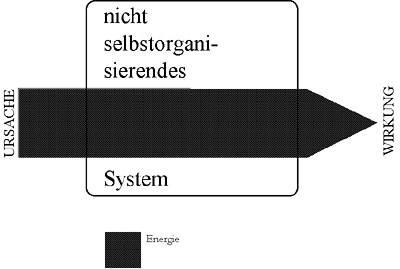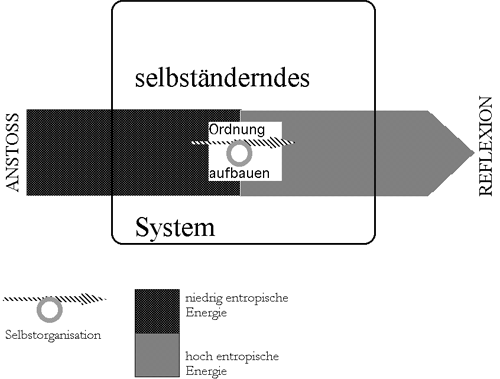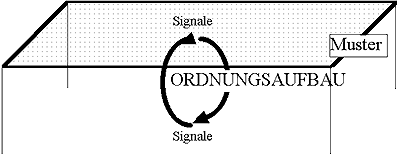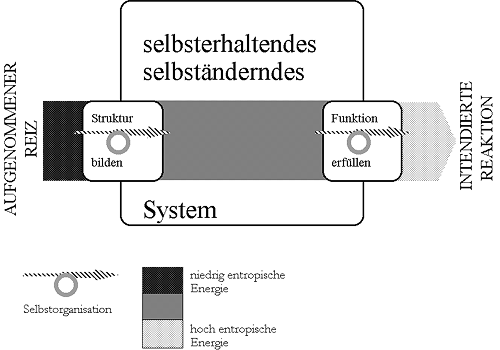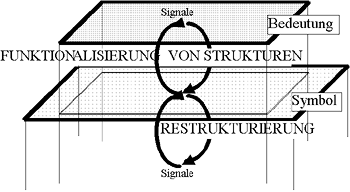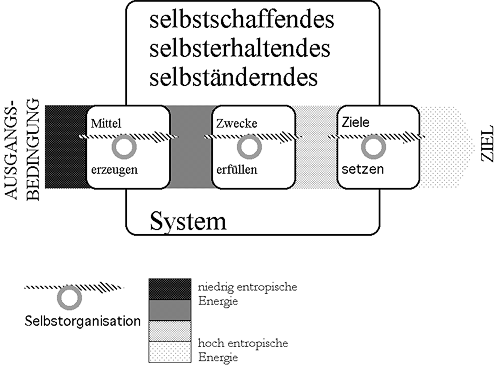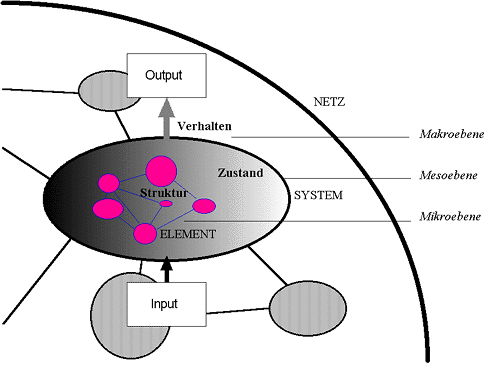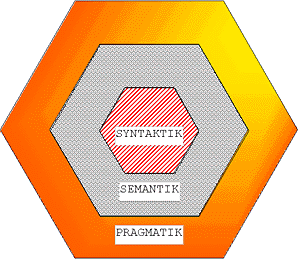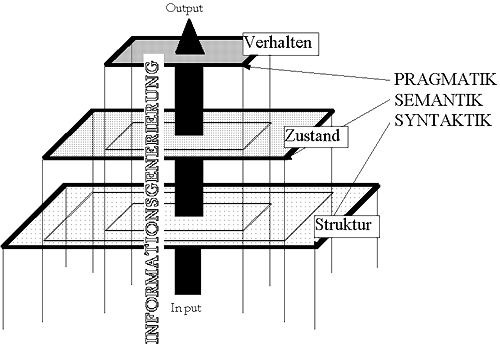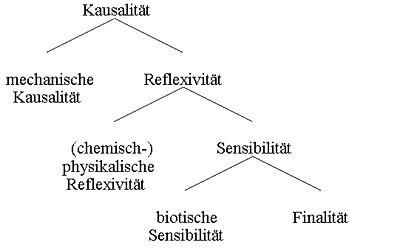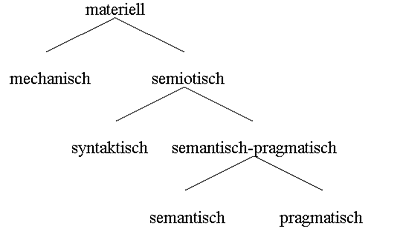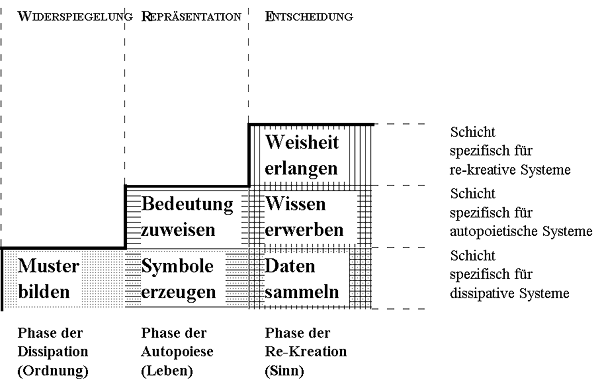| Wolfgang Hofkirchner Information und Selbstorganisation – Zwei Seiten einer Medaille (1) In: Fenzl, N., W. Hofkirchner, G. Stockinger (Hg.): Information und Selbstorganisation. Annäherungen an eine vereinheitlichte Theorie der Information. Studienverlag, Innsbruck 1998, 69-99 INHALT:
Eine einheitliche Informationstheorie fußt auf einem entwickelten Informationsbegriff. Die folgenden Ausführungen verstehen sich als Skizzierung von Eckpunkten eines nicht linear aufgefaßten Stufenmodells der Information unter dem Eindruck der Forschungen zur Selbstorganisation von Systemen.
1. Information – Die Geschichte eines Begriffs Das Wort „Information“ ist in aller Munde. Es wird in Alltag und Wissenschaft häufig benutzt. Das mag als Indikator dafür gedeutet werden, daß der Stellenwert dessen, was mit diesem Wort bezeichnet wird, im gesellschaftlichen Leben heute im Vergleich zu früheren Zeiten gewachsen ist. Daß etwas zu einer allgemeinen, d.h. verbreiteten Erscheinung wird, ist auch eine gute Voraussetzung dafür, ihr Wesen begrifflich auf den Punkt zu bringen (2). Darum geht es in der Debatte um den Informationsbegriff, um eine revidierte Informationstheorie und um die Neu(be)gründung der Informationswissenschaft. Es scheint angebracht, diese Debatte in eine historischen Kontext zu stellen. Im folgenden wird auf den Ursprung des Begriffs im Agrarzeitalter, auf seinen Bedeutungswandel im Industriezeitalter und die Diskussion beim Umbruch ins sogenannte Informationszeitalter eingegangen. In dieser Diskussion sind Versuche zur Schaffung eines syntaktischen Informationsbegriffs, eines semantischen Informationsbegriffs und eines pragmatischen Informationsbegriffs zu verzeichnen. Die Suche nach einem einheitlichen Informationsbegriff ist aber noch im Gange. Die Spuren dieses Begriffs lassen sich tatsächlich bis an den Beginn unserer Zivilisation, genauer ins Zeitalter der Agrargesellschaft zurückverfolgen, nämlich in die griechisch-römische Antike (siehe Capurro 1978). Dort verweist das lateinische Nomen informatio bzw. das Verbinformare mit der Stammsilbe forma auf den Begriff „Form“ und damit auf seine griechischen Wurzeln in den Begriffen Typos (tupoz) bzw. Morphe (morfe) bzw. Eidos/Idea (eidoz/idea), die „das Geprägte“ oder „das Prägende“ oder „Umriß“ bzw. „Gestalt“ bzw. „Form“ bedeuten. Das Zeitwort informare heißt danach etwas „prägen“, „eine Gestalt verleihen“, „eine Form geben“, also etwas „in eine Form bringen“. Das dazugehörige Hauptwort informatio hat demgemäß zwei grundsätzliche Bedeutungen: 1. die der Tätigkeit des In-eine-Form-Bringens und 2. die des Ergebnisses der Tätigkeit, des In-eine-Form-Gebracht-Seins. Je nach Subjekt und Objekt der Tätigkeit kannten die Antike und das nachfolgende (scholastische) Mittelalter im einzelnen mehrere Konnotationen:
Die Formungen beinhalteten damals schon – in der artifiziellen, in der erkenntnistheoretischen und in der organologischen Verwendung des Terms explizit (Capurro 1978: 60, 97), wahrscheinlich aber auch im pädagogischen und im metaphysischen Sprachgebrauch implizit – die Setzung von Unterschieden der Qualität nach. Also, das In-formieren kennzeichnete einen Prozeß, als dessen Resultat etwas Neues entstand. Das Zeitalter der Industriegesellschaft brachte einen Bedeutungswandel des Informationsbegriffs. Er diffundierte aus dem Lateinischen in die Nationalsprachen und erhielt einen alltagssprachlichen Inhalt, der nicht mehr alle mittelalterlichen Bedeutungen umfaßte. In pädagogischer Hinsicht trat mit dem Aufkommen der neuzeitlichen Philosophie und Wissenschaft die humanistische Seite der Information als Bildung der Menschen zum Schönen und Guten gegenüber der rationalistischen Seite zurück, die den intellektuellen Vorgang der Mitteilung von Wissen betonte. Im juristischen Bereich wurde der Begriff gebraucht, um die Ermittlung von Wissen zu kennzeichnen. Damit war der Boden bereitet für die schließliche Verarmung der Begriffsbedeutung von der Bezeichnung für den Vorgang der Wissensmitteilung und Wissensermittlung auf die alleinige Bezeichnung dessen, was da mitgeteilt oder ermittelt wird. Diese Entleerung des Informationsbegriffs sollte mit seiner Verkürzung zur Charakterisierung all dessen, was nachrichtentechnisch übertragbar ist, also zum Synonym für die „Nachricht“, gegen Ende des zweiten Weltkrieges am Anfang eines Zeitalters der gesellschaftlichen Entwicklung stehen, das wegen seiner enormen Fortschritte auf dem Gebiet der Telekommunikation und auf dem damit zusammenwachsenden Gebiet der Technisierung geistiger Prozesse seither gerne mit dem Beiwort „Informations-“ geschmückt wird: Informationszeitalter, Informationsgesellschaft. Waren es in früheren Abschnitten der Zivilisation die Techniken des Ackerbaus und der Viehzucht und darauf die industrielle Technik, die der Zeit ihre Namen gaben, scheint diese Rolle jetzt die Technik der Informationsverarbeitung übernommen zu haben, die als das verstanden wird, was Computer tun, nämlich als maschinelle Transformation von Nachrichten nach fixen Regeln. Der Informationsbegriff hat so einen Bereich usurpiert, der vormals dem Begriff der Botschaft (aggelia) vorbehalten war. Wurde Botschaften anfänglich himmlische Herkunft unterstellt, die in einem vertikalen Prozeß von Götterboten und Engeln auf die Erde herab überbracht wurden, so sind sie nun säkularisiert und einem horizontal aufgefaßten Austausch zwischen den Menschen, zwischen Menschen und Maschinen und letztlich zwischen den Maschinen selber anheimgestellt worden (Capurro 1995: 97ff). Die Verdinglichung der Information eröffnete die Möglichkeit der explosionsartigen Verbreitung dieses Konzepts über alle Wissensgebiete hinweg, förderte aber gleichzeitig die Schwächen eines abstrakten Schemas zu Tage, das, auf fachspezifische Probleme angewandt, zu kurz greifen muß, so daß die Diskussion um den Informationsbegriff bis heute nicht abgeschlossen ist. So wurde alsbald als ein Mangel angesehen, daß Shannon und Weaver bei der Konzeption ihres nachrichtentechnischen Sender-Kanal-Empfänger-Modells, das zum Paradigma der Informationstheorie geworden ist, den Aspekt der inhaltlichen Bedeutung von Nachrichten bewußt beiseite gelassen haben und sich eigentlich nur mit einem syntaktischen Informationsbegriff beschäftigen. Dem wurde u.a. von Bar-Hillel und Carnap (1953) mit Versuchen zur Formulierung eines semantischen Informationsbegriffs begegnet, der ebenfalls formalisiert war. Beiden Fassungen der Informationstheorie wurde daraufhin die Vernachlässigung eines weiteren Aspekts – nämlich der Wirkung auf den Empfänger – zum Vorwurf gemacht. Information wurde deshalb pragmatisch als das, was wirkt, aufgefaßt, und Konzepte von Erstmaligkeit und Bestätigung, Verständlichkeit, Kontextabhängigkeit, Ganzheit, Übereinstimmung mit dem Interesse etc. wurden entworfen, welche die Existenz eines Subjekts mit Erwartungen voraussetzen (siehe z.B. Gernert 1996). Die verdinglichte Vorstellung von „Information“, daß Information etwas wäre, was von außen an ein System herangebracht werden könnte und dann von diesem System aufgenommen und weiterverarbeitet werden würde, wird durch die an behavioristische Schulen anklingende pragmatische Fassung des Informationsbegriffes, die Output zu Input eines Systems ins Verhältnis setzt und das System selber als black box behandelt, allerdings auch noch nicht aufgebrochen. So ist der gesamte wissenschaftliche Meinungsstreit um den Informationsbegriff seit Shannon und Weaver von dem Bemühen gekennzeichnet, die Einseitigkeit und Beschränktheit der noch von den militärischen Erfordernissen der Kommunikationstechnologien der vom Welt- und Kalten Krieg geprägten Betrachtungsweise zu verlassen und ergänzende Gesichtspunkte einzubringen. Gesucht wird seit damals also eigentlich ein Begriff, der diese verschiedenen Aspekte (der Syntax, des Abbildcharakters und der Wirkfähigkeit) des realen Informationsgeschehens integrieren kann, ein Begriff, der die nützlichen Ergebnisse der alten Informationstheorie (unter Berücksichtigung der geschichtlichen Wortbedeutung) als Spezialfall subsumiert und sie zu einer wirklich allgemeinen Theorie (nicht (nur) der Übertragung, sondern zuvörderst der Entstehung, der Bearbeitung und der Verwertung) der Information erweitert. Ein solcher einheitlicher Begriff, auf dem eine vereinheitlichte Theorie der Information gründen kann, muß eine logische Situation bewältigen, die wir an anderer Stelle das Capurrosche Trilemma getauft haben (Fleissner/Hofkirchner 1995). Capurro sieht drei Möglichkeiten für den Informationsbegriff, deren er stets eingedenk sein muß, da sie allesamt nicht zufrieden stellen können: Entweder bedeutet er in allen Wissensbereichen
Die erste Möglichkeit: Wären die in den verschiedenen Wissenschaften gebräuchlichen Informationsbegriffe synonym, dann müßte das, was „Information“ genannt wird, etwa auf die Welt der Steine (Physik) im selben Sinn zutreffen wie auf die Welt der Menschen (Psychologie etc.). Dagegen sprechen aber gute Gründe, die die qualitativen Unterschiede zwischen diesen Welten ins Treffen führen. Diese Möglichkeit scheidet damit aus. Die zweite Möglichkeit: Angenommen, die Begriffe seien analog. Welcher der verschiedenen Informationsbegriffe sollte dann das primum analogatum, den Vergleichsmaßstab für die übrigen, und mit welcher Begründung abgeben? Wäre es z.B. der Informationsbegriff einer Wissenschaft vom Menschen, müßte in Kauf genommen werden, zu anthropomorphisieren, wenn nicht-menschliche Phänomene behandelt werden wollen, d.h. fälschlicherweise Begriffsinhalte von einem Bereich – hier dem menschlichen – auf einen anderen zu übertragen, wo sie nicht passen, etwa behaupten zu müssen, daß die Atome miteinander reden, wenn sie sich zu Molekülen verbinden usw. Wäre es z.B. ein physikalischer Informationsbegriff, von dem ausgegangen werden soll, würde eine physikalistische Reduktion des biologischen oder sozial-kulturellen Informationsgeschehens eingehandelt, d.h. die falsche, weil nicht der Komplexität der Gegenstandsbereiche Rechnung tragende Behauptung, was in der Biologie oder in der Kultur informationell abläuft, sei nichts anderes, als was im physikalischen Bereich und mit physikalischen Methoden analysiert werden kann. In jedem Falle eine Konsequenz, die zu verwerfen ist. Aus diesem Grund kommt auch diese Möglichkeit nicht in Betracht. Bleibt noch die dritte Möglichkeit: Wenn die Begriffe äquivok wären, also gleichlautende Worte für unvergleichbare Designate – wie stände es da um die Wissenschaft? Sie gliche dem Turmbau zu Babel, die Fächer könnten nicht miteinander kommunizieren, so wie Kuhn das auch von einander ablösenden Paradigmen annimmt, die Erkenntnisobjekte wären disparat, wenn überhaupt abgrenzbar. Also ist auch die letzte Möglichkeit unbefriedigend. Dies ist das Capurrosche Trilemma (3). Um daher weder an der Suche nach einer Weltformel scheitern zu müssen noch mit der subjektiven Beliebigkeit der Projektionen zwischen den unterschiedlichsten Gebieten jeden allgemeingültigen Anspruch aufgeben zu müssen noch im Fachidiotentum weiter dahin vegetieren zu müssen, müßte ein Begriff gefunden werden, der flexibel genug ist, daß er auf der einen Seite zwar einen Inhalt besitzt, den alle einzelwissenschaftlichen Beschäftigungen mit dem Informationsgeschehen gemeinsam bearbeiten, weil er sich auf Charakteristika bezieht, die sich in den verschiedenen Manifestationen der Information wiederholen, und daß er aber auf der anderen Seite einen für die jeweilige Disziplin einmaligen Inhalt mit umfaßt, einen, der die einzigartigen Züge des konkreten Informationsgeschehens reflektiert, sodaß die in den verschiedenen Einzelwissenschaften gebrauchten Begriffe vergleichbar wie unterscheidbar werden, weil und indem sie Gleiches wie den Unterschied beinhalten. Gesucht ist also ein einheitlicher Informationsbegriff, der Allgemeines und Einzelnes miteinander vermittelt – das Allgemeine als die gesetzmäßigen, notwendigen Bestimmungen jeglichen Informationsgeschehens und das Einzelne als diejenigen Bestimmungen, die bei der konkreten Erscheinungsform hinzutreten und die unverwechselbaren Eigentümlichkeiten des je nach Gegenstandsbereich besonderen Informationsgeschehens ausmachen, wobei Allgemeines und Einzelnes mit der Betrachtungsebene variieren. Ein vereinheitlichter Informationsbegriff ist nicht nur denkmöglich. Er wird im Augenblick auch real möglich dadurch, daß Forschungen zur „Selbstorganisation“ theoretische und methodologische Einsichten bereitstellen, die geeignet sind, seine Neufassung zu unterstützen.
2. Selbstorganisation – Der Theorienaufbruch in der Gegenwart Was von den Untersuchungen der Phänomene der Selbstorganisation der realen Welt und den aus ihrer Erforschung entspringenden Theorie-Ansätzen – eingeleitet in den 60er/70er Jahren mit Entdeckungen und Modellen über synergetische Effekte bei der Selbststrukturierung der Materie im Laserlicht (Haken/Wunderlin 1991), das Entstehen dissipativer Strukturen bei chemischen Reaktionen (Prigogine/Stengers 1993), die Entstehung lebendiger Materiestrukturen in einem Hyperzyklus autokatalytischer Reaktionen (Eigen et al. 1985), die Autopoiese über neuronale Mechanismen verfügender organismischer Strukturen (Maturana/Varela 1987) und die Resilienz von Ökosystemen (Holling 1973), mit systemtheoretischen und kybernetischen Beiträgen (Bertalanffy 1968, Foerster 1962), mit mathematischen Überlegungen zum deterministischen Chaos (Lorenz 1976) und zur fraktalen Geometrie (Mandelbrot 1982) und fortgesetzt in den 80er Jahren in verstreuten Ansätzen mit Überlegungen zur Soziologie (Luhmann 1984), Ökonomie (Blaseio 1986, Bauer/Matis 1989, Laszlo/Liechtenstein 1992, Warnecke 1992), Geschichts- und Zukunftswissenschaft (Mannermaa 1991) – angestoßen wird, ist ein Paradigmenwechsel sondergleichen: Er erfaßt nicht nur eine einzige Wissenschaft, sondern berührt das gesamte Weltbild. Denn alle diese Ergebnisse und Schlußfolgerungen drängen zur Verallgemeinerung über die Grenzen der eigenen Disziplin hinaus und gruppieren sich zum Bild einer sich herauskristallisierenden Theorie offener, dynamischer, komplexer, nichtlinearer, evolutionärer Systeme, die als neue Querschnittswissenschaft nach einer neuen philosophischen Begründung verlangt und ihrerseits jedem Wissensbereich eine neue Grundlage zur Verfügung stellt. Philosophisch-methodologisch knüpft sie an die sogenannte Emergenztheorie an, theoretisch verknüpft sie die Evolutionstheorie mit der Systemtheorie. Die Emergenzphilosophie (4) befaßt sich mit der Emergenz, d.i. das Auftauchen von Eigenschaften oder Dingen, die sich von denjenigen Eigenschaften und Dingen, aus denen sie auftauchen, unterscheiden (vgl. Fenzl et al. 1996). Gemeint sind die Dialektik von Altem und Neuem, was den Prozeß der Hervorbringung der sich unterscheidenden Eigenschaften oder Dinge betrifft, und die Dialektik von Teil und Ganzem, was die Struktur der hervorgebrachten Eigenschaften und Dinge anbelangt. Die Realität kann also ontologisch als diachron und synchron zugleich unterstellt werden, wobei beide Seiten, die Dynamik und die Statik, ineinander übergehen und sich gegenseitig bedingen. Zusammen konstituieren sie den Entwicklungszusammenhang: Das Neue entsteht zuerst als Teil des alten Ganzen und schreitet fort bis zu einem gewissen Punkt, an dem die Dominanz des Alten über das Neue in die Dominanz des Neuen über das Alte umschlägt und die neue Ganzheit sich die Teile des Alten unterordnet. Das Besondere, das den Unterschied des Neuen zum Alten ausmacht, ist dann nicht mehr Teil des Alten, sondern das Wesentliche, und als dieses unterwirft es einer Umgestaltung, was nunmehr dem Alten und dem Neuen gemeinsam, was deren Allgemeines, ist. Emergenz schlägt in Dominanz um. Der Emergentismus impliziert eine Methodologie, die jenseits der Extreme des Reduktionismus und des Holismus angesiedelt ist (siehe Tab. 2.1). Der Reduktionismus reduziert das Neue auf nichts als das Alte und das Ganze auf nichts als dessen Teile. Er kennt keine emergenten Eigenschaften oder Dinge, diese resultieren vielmehr aus ihrer Voraussetzung, die eine hinreichende Bedingung darstellt. Der Reduktionismus scheitert daran, das Auftauchen des Neuen aus dem Alten als solches qualifizieren zu können, wenn er es in der Erklärung aus dem Alten herleiten will, denn entweder ist das Neue gar nicht neu, weil es im Alten bereits enthalten ist (und durch die Entwicklung nur mehr ausgerollt zu werden braucht), oder das Alte ist gar nicht alt (wie das die Abart der Reduktion, die Projektion der neuen Qualitäten in die alten, nahelegt), und er scheitert daran, das Ganze als Makrodetermination für die Teile anzuerkennen, wenn er dieses Ganze in der Erklärung auf seine Teile zurückführen will, weil er Qualitäten einer höheren Schicht auf Qualitäten einer niedrigeren Schicht zurechtstutzt oder die ersteren auf die zweiteren projiziert (in denen sie nur teilweise vorhanden sind), um sie ableiten zu können.
Tab. 2.1: Methodologische Schlußweisen Der in der wissenschaftlichen Diskussion als „Holismus“ bezeichnete Anti-Reduktionismus im schlechten Sinn verabsolutiert das qualitativ Neue gegenüber dem Alten und das Ganze gegenüber seinen Teilen. Auch er kennt keine emergenten Eigenschaften oder Dinge, weil er diese nicht aus anderen auftauchen, sondern unabhängig von ihnen, voraussetzungslos, existieren läßt. Dieser Holismus ist ein philosophischer Dualismus/Pluralismus im Sinne eines Partikularismus und eigentlich ein Atomismus, insofern jeder Zusammenhang zwischen Teil und Ganzem und Alt und Neu bestritten wird. Es handele sich um inkommensurable Bereiche unterschiedlicher Qualitäten. Der Emergentismus hingegen erklärt das Alte und die Teile zur notwendigen Voraussetzung des Neuen und des Ganzen, ohne sie hinreichen zu lassen. Er läßt das Neue mehr sein als das Alte und das Ganze mehr als seine Teile, ohne das Hervorgehen aus dem Alten und das Zusammenwirken der Teile zu negieren. Der Emergentismus reduziert weder Neues auf Altes oder das Ganze auf seine Teile, noch reißt es die Qualitäten verschiedener Entwicklungsphasen und Schichten auseinander. Dem Reduktionismus pflichtet er bei, wo er die höhere Qualität in der niedrigeren angelegt sieht, und dem Holismus gibt er recht, wenn dieser die eigenständige Qualität der höheren Stufe betont. Den Qualitätssprung sieht er nämlich als kontinuierlich und diskontinuierlich zugleich. Angelegt ist er auf der jeweiligen Stufe der Möglichkeit nach, aber solange er nur angelegt ist, ist er eben noch nicht verwirklichte Möglichkeit. Eigenständig ist er, sobald er diese Möglichkeit zur Wirklichkeit gemacht hat und dabei die Wirklichkeit der Stufe, aus der er hervorgegangen ist, in sich aufgehoben hat. Gespeist aus der Philosophie der Emergenz, und umgekehrt, diese befruchtend, wachsen in der entstehenden Theorie evolutionärer Systeme zwei Theorien zusammen: die Evolutionstheorie und die Systemtheorie. Mit der Umfangserweiterung des Evolutionsbegriffs auf den gesamten Kosmos und mit der Dynamisierung der Systemtheorie I zur Systemtheorie II (den Übergang von der Kybernetik I zur Kybernetik II eingeschlossen) rückt eine Theorie in greifbare Nähe, die nicht mehr die Entwicklung der Arten (Evolutionstheorie nach Darwin) und nicht mehr die Mechanismen, die Strategien und Steuerungsmöglichkeiten von Systemen zur Aufrechterhaltung oder Erreichung innerer Gleichgewichtszustände (Systemtheorie I und Kybernetik I) allein thematisiert, sondern die das Werden, Entfalten und Vergehen, also die Entwicklung, gleich welcher Systeme – von der Bildung der frühesten Partikel, von denen die Menschheit Kenntnis hat, über die Entstehung terrestrischer Lebensformen bis zur Ausbildung bestimmter Subsysteme humaner sozio-technischer Systeme – zum Gegenstand ihrer Erkenntnis macht. Diese Theorie bricht die kurzgeschlossenen Ursache-Wirkungsverhältnisse durch das Dazwischentreten von spontaner Eigenaktivität selbständiger Entitäten auf, deren Verhalten nicht restlos auf äußere Ursachen und innere Mechanismen zurückgeführt werden kann, weil objektiv Wahlmöglichkeiten und „Entscheidungsfreiheiten“ existieren, die alle gleichermaßen, wenn auch vielleicht mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit, verwirklicht werden könnten, von denen aber schließlich nur eine wahrgenommen werden kann. Notwendig ist in diesem Sinn nur mehr überhaupt das Einschlagen eines mehr oder minder beliebigen Weges von mehreren möglichen Wegen, aber nicht mehr nur ein einziger Weg. Selbstorganisation heißt dann im Rahmen dieses Ansatzes, daß der Entwicklungspfad von Systemen, die sich fern vom thermodynamischen (und chemischen) Gleichgewicht befinden, Bifurkationspunkte aufweist, an denen das System gezwungen ist, einen von mehreren möglichen, wenn auch vielleicht unterschiedlich wahrscheinlichen Wegen der weiteren Entwicklung einzuschlagen. Auf eine Phase eines relativ stabilen Entwicklungspfades eines Systems kann aufgrund innerer oder äußerer Änderungen in den Randbedingungen eine Phase amplifizierter Fluktuationen in Parameterwerten folgen, die eine Bifurkation indizieren. Das System kann sich von selbst höher organisieren und wieder auf einen Pfad relativ stabiler Entwicklung auf einem anderen Niveau einschwenken, es kann aber auch einfach zusammenbrechen. So wird in der Theorie evolutionärer Systeme die Realität als Gesamtheit der Bewegung auseinander hervorgegangener, sich gegenseitig beeinflussender und auch weiterhin in Entwicklung befindlicher Systeme begreifbar. Das heutige Universum erscheint mit all seinen Teilsystemen als aus einer Kette ineinandergeschachtelter Selbstorganisationszyklen hervorgegangen (siehe als früheste Werke dazu die von Laszlo 1972a, 1972b, und zur gegenwärtigen Diskussion z.B. Ebeling/Feistel 1994, Goerner 1994, Kanitscheider 1993, Mainzer 1994, Sandvoss 1994) (siehe Abb. 2.1).
Abb. 2.1: Die Kegel der Evolution (5)
3. Information und Selbstorganisation – Umrisse einer künftigen Informationstheorie Wird davon ausgegangen, daß die im Entstehen begriffene Theorie evolutionärer Systeme einen Hintergrund liefert, vor dem die Erscheinungen der Wirklichkeit besser beschrieben, erklärt oder vorausgesagt werden können als vor anderen zur Verfügung stehenden Theorien vergleichbar großer Reichweite – und davon will ich hier ausgehen –, dann muß auch akzeptiert werden, daß eine vereinheitlichte Informationstheorie, die ebenfalls noch auszuarbeiten bleibt, in das Weltbild der Selbstorganisation einzubetten ist. Will die evolutionäre Systemtheorie eine Theorie von der Information integrieren, stehen eventuelle Vorleistungen auf ihrer Seite zur Debatte, vorausgesetzt, daß es bedenkenswerte und bewahrenswerte Ideen zur Information gibt, was ich ebenfalls unterstelle. Und umgekehrt: Genauso muß nach den Vorgaben gefragt werden, die eine vereinheitlichte Informationstheorie erfüllen muß, wenn sie in den Rahmen einer vereinheitlichten Selbstorganisationstheorie passen will. Die eine Voraussetzung, die m.E. gemacht werden muß, um Information in die Selbstorganisation begrifflich einkoppeln zu können, und welche das Modell der Selbstorganisation betrifft, lautet: (1) Selbstorganisation ist informiert. Sie folgt aus der Prämisse: Wenn es keine Selbstorganisation ohne das Hervorbringen von Qualitätsumschlägen gibt, und wenn das Hervorbringen von Qualitätsumschlägen das Setzen von Unterschieden bedeutet, dann gibt es auch keine Selbstorganisation ohne Information, sofern das Setzen von Unterschieden ein Informationsgeschehen darstellt. D.h.: Prozesse der Selbstorganisation, insofern in ihnen Neues auftaucht, generieren Information. Das zum ersten. Die andere Voraussetzung bezieht sich auf das Bild von der Information und kann so zusammengefaßt werden: (2) Information ist selbstorganisiert. Dies begründet sich darin, daß das Informationsgeschehen als (Moment in einem) Entwicklungsgeschehen aufgefaßt wird: Wenn alle Entwicklung und jedes ihrer Momente selbstorganisiert sind, dann ist auch die Information als Geschehen selbstorganisiert. D.h.: Sie ist ein Prozeß, in dem Neues entsteht, und wie jeder derartige Prozeß schichtet sie ihre Geschichte in ihrem Resultat auf und verwandelt das Resultat in die Ausgangsbedingungen ihres weiteren Verlaufs. Das zum zweiten. Beide Annahmen gelten sowohl für einen beliebigen einzeln auftretenden Fall eines Informationsprozesses als auch für den Gesamtzusammenhang, den die einzelnen Informationsprozesse stiften. Zusammengenommen heißen die Annahmen 1 und 2: Informationsprozesse wie Selbstorganisationsprozesse haben dasselbe Subjekt: das evolutionäre System. Während es sich selbst organisiert, informiert es sich. Selbstorganisation von Systemen besitzt als untergeordnetes Moment, als Teilgeschehen, oder, vielleicht besser, als Teilaspekt des Gesamtgeschehens, Information; und Information steuert zur Selbstorganisation von Systemen bei. Im folgenden soll dem informationellen Charakter des Geschehens der Selbstorganisation von Systemen und dem systemisch-evolutionären Charakter des Informationsgeschehens nachgegangen, sollen Eckpunkte einer vereinheitlichten Auffassung skizziert werden. Zunächst wird die Informiertheit der Selbstorganisation betrachtet. Die Herausbildung von Systemen, die zur Generierung von Information fähig sind, und Phasen der Entfaltung solcher Systeme stehen im Vordergrund. Dabei zeigt sich, daß der Relativierung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen eine Schlüsselrolle zukommt und es so viele Grundtypen von Informationsprozessen gibt, wie es Grundtypen der Selbstorganisation von Systemen gibt. Danach wird die Selbstorganisiertheit der Information behandelt. Um die Schichtenstruktur der Informationsprozesse zu erhellen, wird auf die Unterteilung des Systemaufbaus in drei hierarchische Ebenen und auf deren Zusammenhang mit den Dimensionen von Zeichen, die das Produkt von Informationsprozessen darstellen, eingegangen. Schließlich werden beide Komponenten vereint und die Phasen und Schichten der Informationsgeschehen manifestierenden Systeme zu Stufen zusammengefaßt. 3.1. Die evolutionäre Komponente: Genese von Informationsstrukturen Das mechanistische Weltbild, das mit dem Namen Newtons assoziiert wird und von Laplace so auf den Punkt gebracht worden ist, daß das gesamte Universum ein Mechanismus sei und ein Dämon, der zu einem bestimmten Zeitpunkt die vollständige Kenntnis über den Zustand des Universums besäße, jeden beliebigen Zustand davor und jeden beliebigen danach errechnen könne, ein Weltbild, für dessen Jahrhunderte lange Verbreitung durch die Wissenschaftler sich Sir James Lighthill (1986) beim gebildeten Publikum entschuldigen zu müssen geglaubt hat, ist ein streng deterministisches; es hat die Vierzahl der aristotelischen Ursachen auf die Wirkursache eingeschränkt und kennt nur eineindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Gleiche Ursachen haben demnach gleiche Wirkungen, verschiedene Ursachen verschiedene Wirkungen. In systemtheoretischer Sprechweise, bei der zwischen Ursachen und Wirkungen ein System als intervenierende Variable gedacht wird und die Ursachen als die Inputs in ein System und die Wirkungen als die Outputs aus dem System aufgefaßt werden, heißt dieser strenge Determinismus (vgl. Heylighen 1990): Die Inputs und die Outputs eines Systems werden derart zueinander in Beziehung gesetzt, daß jeder Input einem und genau einem Output zugeordnet wird. Mathematisch läßt sich dies als eine eineindeutige Abbildung beschreiben. Das System transformiert auf eine vorbestimmte Weise den Input in den Output. Diese Transformation ist rechenbar (siehe Abb. 3.1.1).
Abb. 3.1.1: Die eineindeutige Zuordnung von Inputs und Outputs in mechanischen, streng deterministischen Systemen In diesem Sinne gilt: causa aequat effectum, oder, wie wir an anderer Stelle Newtons Diktum reinterpretierten (Fleissner/Hofkirchner1997), actio est reactio. Dies gilt, solange mechanische Systeme betrachtet werden, nicht mehr aber, wenn nicht-mechanische evolutionäre Systeme in den Blick kommen, die sich nicht im oder nahe am thermodynamischen oder chemischen Gleichgewicht befinden. Wo Systeme Feldern ausgesetzt sind, in denen die ungleiche Verteilung der Energiedichte einen kritischen Wert überschreitet, können kleine Ursachen große Wirkungen haben, ähnliche Ursachen unähnliche Wirkungen. Wieder systemtheoretisch gesprochen, kann dieser Fall so beschrieben werden (vgl. wieder Heylighen 1990): Inputs und Outputs sind nicht mehr mathematisch bijektiv zueinander in Beziehung zu setzen. Derselbe Input kann mit verschiedenen Outputs verbunden werden, derselbe Output mit verschiedenen Inputs. Das System verwandelt zwar nach wie vor den Input in den Output, es hat aber die Freiheit, zwischen mehreren Möglichkeiten zu wählen. Dieser Verwandlungsprozeß ist nicht mehr unbedingt rechenbar (siehe Abb. 3.1.2).
Abb. 3.1.2: Die mehrdeutige Zuordnung von Inputs und Outputs in Systemen fern vom thermodynamischen/chemischen Gleichgewicht So kann im Unterschied zum mechanischen Fall gesagt werden: causa non aequat effectum bzw. actio non est reactio. Um der Tatsache gerecht zu werden, daß im Lauf der Evolution Systemwirkungen auftauchen, die nicht vollends auf ihre Ursachen rückführbar sind, muß keinem prinzipiellen Indeterminismus das Wort geredet werden, und es muß auch nicht das Kausalitätsprinzip überhaupt fallengelassen werden. Es reicht aus, den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, der dem Kausalitätsprinzip in seiner streng deterministischen Fassung innewohnte, zurückzunehmen. Das Kausalitätsprinzip besagt dann nur, daß Wirkungen Ursachen haben und umgekehrt Ursachen Wirkungen, d.h. daß Ereignisse andere Ereignisse hervorbringen (vgl. Hörz 1971, 208); und ob die Vermittlung zwischen den Ereignissen, zwischen Ursachen und Wirkungen, streng determiniert ist oder weniger streng, flexibler, uneindeutig, macht es abhängig von den an der Vermittlung beteiligten Systemen. Kausalbeziehungen lassen sich also differenzieren in mechanische und nicht-mechanische Kausalbeziehungen je nachdem, ob es sich um mechanische oder nicht-mechanische Systeme handelt, die sie vermitteln. 3.1.1. Selbständerung durch Widerspiegelung: Der Ursprung der Information in dissipativen Systemen Die mechanischen Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind dadurch gekennzeichnet, daß der Einfluß des zwischen Ursache und Wirkung dazwischengeschalteten Systems eine vernachlässigbare Größe darstellt, daß das System die Einwirkung, die es von außen erfährt, quasi passiv erleidet, daß es fremdbestimmt wird, fremdorganisiert. In physikalischer Hinsicht ist das System in seiner Stofflichkeit energetischen Strömen gegenüber offen, denen es aber keine Anreize für selbständige Arbeitsleistungen abgewinnen kann. Es übersetzt die Ursache in die Wirkung, ohne dieses Geschehen zu seiner eigenen Tat zu machen. Außer Stoff(-) und Energie(flüssen) ist nichts an der Umsetzung der Kausalität beteiligt; es tritt keine Information auf (siehe Abb. 3.1.1.1).
Abb. 3.1.1.1: Das Ursache-Wirkungs-Verhältnis bei mechanischen Systemen Selbstorganisierende Systeme zeigen demgegenüber eine Eigenaktivität, die in der Vermittlung der Ursache zur Wirkung zur bestimmenden Einflußgröße wird: Das System bestimmt selbst, welche Wirkung es auf eine Ursache hin zeigt, es spiegelt die Ursache in einer von ihm selbst bestimmten Wirkung wider, es reflektiert seine Umwelt auf seine je eigene, unverwechselbare Art und Weise. Die bestimmte Ursache und die bestimmte Wirkung sind nicht mehr notwendig miteinander verbunden. Die Ursache ist nicht mehr notwendige und hinreichende Bedingung für die Wirkung. Sie wird zur nur mehr notwendigen, nicht jedoch hinreichenden Bedingung. Sie wird zur Voraussetzung, ohne die es zwar keine Wirkung geben könnte, mit der aber noch nicht bestimmt ist, ob die Wirkung so oder anders ausfällt. Die Ursache wird zum Auslöser eines Selbstorganisationsprozesses, der keine strikte Determination kennt, sie wird zum Initiator eines Vorganges, der ein Eigenleben gewinnt, sie wird zur Anregung für das System, das diese nach seiner eigenen Maßgabe aufnimmt, verarbeitet und verwertet (6). Das System ändert sich selbst. Diese Art der Kausalität könnte „Reflexivität“ (7) genannt werden. Ganz allgemein äußert sich die Reflexion eines Anstoßes als Aufbau von Ordnung. In thermodynamischer Sicht nimmt das System den einfließenden Energiestrom zum Anlaß, Arbeit zu leisten, mit der es Ordnung aufbaut, und verstreut (dissipiert) die dabei entwertete Energie wieder in die Umwelt. Ja es hält seine selbstorganisierte Ordnung auch nur solange aufrecht, wie der Energiefluß aufrecht bleibt. Die Entropie gilt als Maß der Qualität der Energie, das angibt, wieweit die Energie für eine Arbeitsleistung des Systems zur Verfügung steht. Je höher die Entropie, desto geringer die Verfügbarkeit. Solche Systeme können daher – frei nach dem Vorschlag der Prigogineschen Schule (z.B. Prigogine/Stengers 1993) – „dissipativ“ genannt werden (siehe Abb. 3.1.1.2).
Abb. 3.1.1.2: Das Ursache-Wirkungs-Verhältnis bei dissipativen Systemen (Reflexivität) Die Reflexion ist auf den Anstoß nicht zurückzuführen. Die Wirkung trennt von der Ursache ein Qualitätssprung auf eine andere Ebene. Weil und insofern nun dieser Qualitätssprung darin besteht, daß das System bei seiner wirklichen Antwort, mit der es eine Sache aus seiner Umwelt reflektiert, aus einer Reihe mehrerer möglicher Antworten selektiert, daß es die Option, die es realisiert, unter mehreren Optionen auszeichnet, daß es also eine (Entscheidung zur) Unterscheidung trifft und das Treffen einer Unterscheidung, das Setzen eines Unterschieds, nichts anderes als das Generieren von Information bedeutet, steht die Selbstorganisation am Ursprung der Information. Neben den Stoffströmen und Energieflüssen, die auch sonstige offene Systeme kennzeichnen, gibt es bei dissipativen Systemen einen Qualitätssprung: das Auftauchen von Information, das dem Stoff- und Energieaustausch den Charakter einer Quelle der selbständigen Höherorganisierung des Systems verleiht. Das System gibt im Prozeß der Selbstorganisation der Wirkung ihre Form, indem es sich selbst formt, sich umformt, neu formt. Es setzt sich in (eine ganz bestimmte und keine andere) Form (und damit von der Form ab, die es bisher innehatte), und daher informiert es sich. Das Umweltereignis, das den Anstoß zum Ordnungsaufbau gibt, wird gleichzeitig zu einem Signal für die Auslösung eines Informationsprozesses, in dem ein Muster gebildet wird, das wiederum als Signal für andere Systeme in der Umwelt dienen mag. Was von der stofflich-energetischen Seite her als Ordnungsaufbau erscheint, ist von der informationalen Seite her die Musterbildung. Im Muster setzt das System seine Unterscheidung (siehe Abb. 3.1.1.3).
Abb. 3.1.1.3: Die Struktur des Informationsprozesses in dissipativen Systemen (Widerspiegelung) Das Muster ist das Ergebnis der Aktivität, mit der das System auf ein Ereignis aus der Umwelt eine Antwort gibt, die in einer ganz bestimmten Änderung seiner Organisiertheit besteht. Damit wird das Muster zum Zeichen und die Musterbildung zum Zeichenprozeß, bei denen sich zeichentheoretisch alle drei Dimensionen der Syntaktik, Semantik und Pragmatik abhandeln lassen: Die syntaktische Dimension des Musters findet sich in der Regelhaftigkeit seines Zustandekommens (das System kann nicht zu jeder Zeit jedes beliebige Muster bilden); die semantische Dimension in seiner Zugeordnetheit auf einen bestimmten Sachverhalt in der Systemumwelt; die pragmatische Dimension in der Äußerung der Tätigkeit des Systems selbst. Der Prozeß der Selbstorganisation des Systems wird zum Generator der Information des Systems. Und ohne Information, die Unterscheidung, kann das System sich nicht selber organisieren. 3.1.2. Selbsterhaltung durch Repräsentation: Die Weiterentwicklung der Information in autopoietischen Systemen Die Auflösung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen in einen Fächer differenzierter Kategorien – mechanische und Anstoß-Reflexions-Beziehung – läßt sich freilich noch weiter treiben. Denn reflektierte Kausalbeziehungen finden sich nach der hier eingeführten Terminologie von physikalischen und chemischen Systemen wie den Bénard-Zellen, dem Laser, den chemischen Blinkern bis zu sozialen Systemen wie den Wirtschaftsunternehmen. Darum scheint es angezeigt, zumindest zwei weitere Unterscheidungen zu treffen und die Struktur der Informationsprozesse entsprechend zu differenzieren. Die hier vorgenommene Einteilung ist deckungsgleich mit der im Alltag wie in der Wissenschaft üblichen Einteilung in biotische Systeme und soziale Systeme. Die erste Unterscheidung ist die zwischen einfachen reflexiven Verursachungen – bei reinen (chemisch-)physikalischen selbstorganisierenden Systemen – auf der einen Seite und solchen komplexeren auf der anderen Seite, bei denen die Wirkungen zu intendierten Reaktionen auf aufgenommene Reize als Ursachen werden, was bei allen lebenden Systemen der Fall ist und unter dem Begriff der Reizbarkeit, Sensibilität, bekannt ist. Bei solchen dissipativen Systemen, die eine Reiz-Reaktions-Beziehung zeigen, tritt eine Verdoppelung des Selbstorganisationszyklus auf, wobei der eine auf dem anderen aufsetzt. Diese Systeme sind nämlich im Gegensatz zu einfachen dissipativen Systemen zu einer (begrenzten) Verstetigung des Energiedurchflusses und damit zur (begrenzten) Aufrechterhaltung der von ihnen aufgebauten Ordnung fähig, indem sie den Stoff- und Energiewechsel dazu verwenden, die Bestandteile, aus denen sie zusammengesetzt sind, immer wieder selber herzustellen. Aufgrund dieses Merkmals sind sie als „autopoietische“ (selbstherstellende) Systeme in die Literatur eingegangen. Strukturen, die im Verlauf der Selbstorganisation gebildet werden, sind nicht mehr Selbstzweck, sondern erlangen eine Funktion im Rahmen der Aufrechterhaltung der Ordnung, wofür sie als Mittel dienen. Die Strukturen werden hinsichtlich ihrer Eignung für die Perpetuierung des Lebensprozesses funktionalisiert (siehe Abb. 3.1.2.1). Die Systeme erhalten sich selbst.
Abb. 3.1.2.1: Das Ursache-Wirkungs-Verhältnis bei autopoietischen Systemen (Sensibilität) Wenn lebenden Systemen eine Tendenz innewohnt, ihr Leben zu perpetuieren, dann müssen, um Reaktionen intendieren zu können, die zur Steigerung der Überlebensfähigkeit beitragen, die Umweltreize derart widergespiegelt werden, daß das System erkennen kann, ob sie seinem Lebensprozeß entweder förderlich oder abträglich oder ihm gegenüber neutral sind (vgl. Ayres 1994). Der korrespondierende Informationsprozeß durchläuft dementsprechend dieselben zwei Stufen der Selbstorganisation, die in einem Sensorium und einem Effektorium getrennt lokalisiert werden können. Restrukturierungen erbringen etwas, das Symbole genannt werden darf, denen vom System eine Bedeutung für sein Überleben beigemessen wird, was umgekehrt heißt, daß Strukturierungen bereits nach diesen Gesichtspunkten vorgenommen werden (siehe Abb. 3.1.2.2). Der Unterschied in der Struktur macht einen Unterschied für das Weiterbestehen des Systems.
Abb. 3.1.2.2: Die Struktur des Informationsprozesses in autopoietischen Systemen (Repräsentation) Symbol und Bedeutung gelten hier als Ausdifferenzierungen von Zeichen, zu denen die Widerspiegelung führt, weil diese die Qualität einer Repräsentation erlangt. Eine Repräsentation liegt insofern vor, als das Zeichen durch eine gewisse Struktur (eben das Symbol) die Funktion eines Umweltereignisses für die Aufrechterhaltung des Systems (eben die Bedeutung) darstellt. In der Struktur kommt die syntaktische Dimension des Zeichens getrennt von den beiden anderen Dimensionen zum Tragen, welche in der Funktion beieinander liegen. Der Fähigkeit zur Repräsentation verdanken die selbstorganisierenden Systeme ihre gesteigerten Anpassungsleistung an ihre Umwelten, die sie in die Lage versetzt, sich nicht nur zu restrukturieren, sondern auch sich immer wieder selbst herzustellen, zu reproduzieren. 3.1.3. Selbstschaffung durch Entscheidung: Die Ausdifferenzierung der Information in re-kreativen Systemen Die zweite Unterscheidung ist die zwischen einfachen Reiz-Reaktions-Beziehungen – bei reinen biotischen Systemen – auf der einen Seite und komplexeren von ihnen auf der anderen Seite, wo die Wirkungen als Verwirklichungen selbstgesteckter Ziele figurieren und die Ursachen als Ausgangs- oder Randbedingungen dafür, wie das für alle sozialen Systeme, die von Menschen geschaffen werden, typisch ist, und was als teleologische Beziehungen, als Relation der Finalität, verstanden wird. Derartige Systeme zeigen eine noch größere Anpassungsleistung als die einfachen autopoietischen Systeme: Sie passen nämlich die Umwelt an sich an. D.h. ihr Wirkungsfeld wird von einer Rückkopplungsschleife geprägt, in der die Systeme durch die gezielte Einwirkung auf die Umwelt solche Bedingungen schaffen, unter denen sie sich selber erschaffen können, weil sie die Ziele, die sie zu erreichen suchen, sich selber ausgesucht haben und sich durch die Verwirklichung der Ziele selbst verwirklichen. Sie schaffen sich selbst neu oder um. Deshalb bezeichne ich sie in Anlehnung an Jantsch (1987, 178) als „re-kreativ“. Sie verfügen über eine weitere Ausdifferenzierung der Selbstorganisationszyklen, die ihnen noch größeren Freiraum verschafft (siehe Abb. 3.1.3.1).
Abb. 3.1.3.1: Das Ursache-Wirkungs-Verhältnis bei re-kreativen Systemen (Finalität) Um Ziele erreichen zu können, bestimmen sie Zwecke, und um Zwecke erfüllen zu können, erzeugen sie Mittel – und umgekehrt: Auf der Basis erzeugter Mittel lassen sich verschiedene Zwecke bedienen und auf der Basis erfüllter Zwecke verschiedene Ziele verfolgen. Auf jeder dieser Stufen erfolgt die selbstorganisierte Einschränkung auf konkrete Mittel, Zwecke, Ziele – eine Auswahl, die wiederum ein Informationsgeschehen darstellt. Wie bei den reinen biotischen Systemen existiert ein Phasenübergang zwischen der Restrukturierung des Systems, welche die Konkretisierung der Mittel leistet, und der Reproduktion des Systems, welche die Zwecke festlegt, aber anders als bei jenen transzendiert die Setzung von Zielen für die Re-Kreation des Systems die Zwecke der Reproduktion und sind die Verhaltensentscheidungen nicht mehr von den Repräsentationen ununterscheidbar. Eine Entscheidung des Systems für ein bestimmtes Systemverhalten fußt zwar auf der inneren Darstellung von Zusammenhängen zwischen Außenbedingungen und Systemerhaltung, kann aber je nach Bewertung entlang unterschiedlicher Zielvorgaben, die in der Regel unterschiedliche Realisierungsformen der Systemerhaltung einschließen, unterschiedlich ausfallen (8). Der Unterschied für das Weiterbestehen des Systems macht einen weiteren Unterschied für das Handeln des Systems. So erhalten wir ein Schema, das drei Ebenen auseinanderhält, die durch Prozesse der Selbstorganisation miteinander verkoppelt sind: Signale aus der Umwelt des sozialen Systems werden durch Umstrukturierungen innerhalb des Systems wahrgenommen, die als Darstellung überlebensrelevanter Zusammenhänge interpretiert werden, die ihrerseits noch einer Bewertung anhand übergeordneter Ziele unterzogen wird (siehe Abb. 3.1.3.2).
Abb. 3.1.3.2: Die Struktur des Informationsprozesses in re-kreativen Systemen (Entscheidung) Die wahrgenommenen Signale bilden Daten, die interpretierten Daten Wissen und das bewertete Wissen Weisheit. Daten – das sind die möglichst vielseitig gemachten Erfahrungen des Systems mit der Umwelt, sie dienen als Material für die Gewinnung von Wissen; Wissen – das ist die möglichst wahre Erkenntnis von tatsächlichen und möglichen Zusammenhängen zwischen System und Umwelt, sie bilden die Grundlage für das Erlangen von Weisheit; Weisheit – das ist die möglichst richtige Anleitung und Anweisung zum Handeln entsprechend der Zielsetzungen des Guten und des Schönen. Daten, Wissen und Weisheit sind die drei Erscheinungsformen, die das Zeichen in sozialen Systemen annimmt. Mit ihnen existieren die semiotischen Dimensionen in auseinandergefalteter Weise in einer bestimmten Aufeinanderfolge. Dem aufsteigenden Informationsprozeß von einer Ebene zur nächsten entspricht ein gegenläufiger, in dem die Weisheit die Bewertung des Wissens beeinflußt, das Wissen der Interpretation der Daten Vorgaben macht und die Daten die Wahrnehmung der Signale kanalisieren.
3.2. Die systemtheoretische Komponente: Struktur von Informationsprozessen Die Auflösung der Kausalität in eine Mehrzahl differenzierter, konkretisierter Beziehungen, die oben in der Akzentuierung des genetischen Aspekts einer vereinheitlichten Theorie von der Information nachgezeichnet worden sind, ist eine der Voraussetzungen für die konzeptive Einklinkung des Informationsgeschehens in die Prozesse der Selbstorganisation. Andere Voraussetzungen betreffen systemtheoretische und semiotische Vorstellungen, die gewisser Modifikationen bedürfen, um der strukturellen Perspektive einer neuen Informationstheorie gerecht werden zu können. Es handelt sich um die Einteilung von Systemen in Ebenen und um die Ineinanderschachtelung der Zeichendimensionen, woraufhin Ebenen und Dimensionen zu Schichten des Informationsgeschehens, dessen Subjekt ein System ist, zusammengefaßt werden können. Zur Bestimmung der Ebenen von Systemen (siehe Fleissner/Hofkirchner 1996). Systeme können in drei verschiedenen Hinsichten betrachtet werden:
Es wird vorgeschlagen, Systemstruktur, Systemzustand und Systemverhalten auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln (siehe Abb. 3.2.1):
Abb. 3.2.1: Die Einteilung der Systemebenen Inputs in das System, gleich welcher Art (ob stofflich-energetisch oder/und informational), wirken demnach auf seine Struktur, in seinem Zustand kommt der Throughput zum Vorschein, und sein Verhalten drückt den Output aus. Für eine vollständige Beschreibung eines Systems ist daher die Angabe sowohl der Struktur als auch des Zustands als auch des Verhaltens obligat. Relevant wird dies für dynamische Systeme, die sich selbst organisieren. Bei mechanischen Systemen kann nämlich das Verhalten auf den Zustand und kann der Zustand auf die Struktur zurückgeführt werden. Mathematisch beziehen sich die Inputfunktion eines Systems auf dessen Struktur, die Zustandsfunktion, wie der Name sagt, auf dessen Zustand und die Outputfunktion auf dessen Verhalten. Diese Funktionen können im Fall mechanischer Systeme gerechnet werden. Im Fall evolutionärer Systeme ist allerdings davon auszugehen, daß zwischen den Äußerungen des Systems auf den drei Ebenen Qualitätssprünge auftreten können, die keine mathematische Überführung ineinander mehr zulassen. Das ist der selbstorganisierenden Aktivität des Systems geschuldet. Von Ebene zu Ebene vermittelt nicht notwendigerweise bloße mechanische Kausalität, sondern mindestens ein Zyklus von Selbstorganisation. Das bedeutet: Die nächsthöhere Ebene eines Systems bringt etwas zum Ausdruck, was nicht unbedingt unter Zuhilfenahme der Systemexpression auf der darunterliegenden Ebene hinreichend erklärbar sein muß. Jedenfalls bildet eine Ebene die notwendige Bedingung für die darauf aufbauende. Die Emergenz von Systemstrukturen, -zuständen, -verhaltensweisen läßt sich so erfassen. Ein Input kann eine Änderung der Qualität der Struktur des Systems hervorrufen. Die qualitativ veränderte Struktur kann – muß aber nicht – eine Änderung der Qualität des Zustands veranlassen, und der qualitativ veränderte Zustand kann – muß aber nicht – in eine Änderung der Qualität des Verhaltens einmünden. Umgekehrt muß aber jedes neue Verhalten auf einer Zustandsänderung fußen wie jede Zustandsänderung auf einer Umstrukturierung. Zur Bestimmung der Dimensionen von Zeichen. Die Semiotik kennt, zumindest, was den Bereich kultureller Artefakte anlangt, grob gesagt drei voneinander unterschiedene Aspekte der Zeichen (und Zusammensetzungen von Zeichen):
Es scheint angebracht, diese drei Zeichenbeziehungen nicht als Aspekte nebeneinandergestellt zu lassen, sondern als Dimensionen zu begreifen, die nach Art einer enkaptischen Hierarchie ineinander greifen (siehe Abb. 3.2.2):
Abb. 3.2.2: Die Ineinanderschachtelung der semiotischen Dimensionen Die syntaktische Dimension bildet den inneren Kern einer Zeichengesamtheit. Jede Zeichengesamtheit muß gewisse Regeln erfüllen, um die Eigenschaft eines konsistenten Zeichens zu erwerben. Diese Mindestvoraussetzung erfüllen aber auch Gebilde, die keinen semantischen Sinn machen, die keine Bedeutung tragen, d.h. nicht auf ein bestimmbares Objekt verweisen. Es muß daher noch etwas hinzukommen, was die Menge aller syntaktisch möglichen Zeichen auf solche einschränkt, denen eine Bedeutung zugeschrieben werden kann. Diese Aufgabe übernimmt die Semantik. Sie spielt die Rolle einer in der Hierarchie weiter oben verortbaren Dimension, die eine Makrodetermination auf die Syntaktik ausübt. Aber auch die Beziehung des Zeichens zum Bezeichneten ist nicht unabhängig von einer weiteren Beziehung, nämlich der zum Bezeichner (bzw. zur Bezeichnerin, wenn es sich um humane Systeme handelt). Nur innerhalb einer Zeichen-Objekt-Subjekt-Beziehung ist die Zeichen-Objekt-Beziehung realisiert, wird die Menge der wirklichen, weil wirkenden, Zeichen-Objekt-Beziehungen aus der Menge aller möglichen Signifikationen ausgezeichnet. Die Pragmatik ist daher die umfassendste der Dimensionen, welche die anderen einschließt. Die jeweils höhere geht inhaltlich über die darunterliegende hinaus und prägt diese, taucht sie in ihr Licht. Damit formen die semiotischen Dimensionen eine Hierarchie, die der der Systemebenen analog ist. Nun liegt die Kopplung der zeichentheoretischen Begrifflichkeit an die systemtheoretische nahe. Wird das Subjekt des Informationsgeschehens als System unterstellt, wobei zunächst davon abgesehen werden kann, welche realweltlichen Systeme gemeint sind, lassen sich die semiotischen Dimensionen leicht auf die systemischen Ebenen beziehen, u.zw. (siehe Abb. 3.2.3):
Abb. 3.2.3: Die Zuordnung der semiotischen Dimensionen zu den Systemebenen Der Informationsprozeß wird also als ein Geschehen skizzierbar, in dem das Setzen von Zeichen (ein Vorgang, der nur in evolutionären Systemen vorkommt, aber auch in allen diesen Systemen vorkommt) über mehrere Ebenen hinweg ablaufen kann und dabei die Bildung entsprechender Schichten nach sich zieht: Information liegt dann vor, wenn entweder infolge eines Selbstorganisationszyklus ein struktureller Qualitätsumschlag, der eo ipso ein syntaktischer ist, auftaucht, oder wenn zusätzlich infolge einer weiteren Selbstorganisationsschleife ein Zustandswechsel und sohin semantischer Phasensprung eintritt, oder wenn darüber hinaus infolge einer darauf aufsetzenden Selbstorganisation ein neues Verhalten und ergo eine pragmatische Neuerung emporkommt; im ersten Fall liegt ein einschichtiges System vor, im zweiten eines mit zwei Schichten und im letzten eines mit dreien. D.h., bezogen auf ein beliebiges System kommt Information dann ins Spiel, wenn ein emergenter Prozeß auf irgendeiner der drei Ebenen zur Schichtenbildung führt, indem er eine qualitative Veränderung der Systemexpression hervorruft. 3.3. Die Konzipierung eines Stufenmodells Mit der Rekonstruktion des Informationsgeschehens als etwas, was evolutionär, d.h. im Gesamtzusammenhang der Evolution des Kosmos und seiner Teile, als eine Abfolge voneinander abgehobener Stadien konzipiert werden kann und systemisch, d.h. im konkreten Einzelfall, als eine Gliederung hintereinander liegender Schritte, wird ein Stufenmodell als methodisches Mittel gewonnen, das historisch und logisch in einem ist, genetisch und strukturell: Als Phasenmodell widmet es sich längsschnitthaft der Emergenz neuer Qualitäten im Evolutionsprozeß, als Schichtenmodell bezieht es sich querschnitthaft auf die Dominanz von Ganzheiten im Ergebnis desselben Evolutionsprozesses. Es verbindet die Aspekte von Phase und Schicht miteinander: Was im einen Fall Voraussetzung ist, wird im anderen zur Folge, die Basis wird zum Produkt, der Ausgangspunkt zum Resultat. Einmal wird ein Entwicklungsbaum verschiedener Formen der Kausalität vorstellbar, die auseinander hervorgehen (siehe Abb. 3.3.1).
Abb. 3.3.1: Logisch-historische Kategorien der Kausalität Zur Erfassung der Wirkungsweise evolutionärer Systeme ist kein Postulat akausaler Beziehungen nötig. Andererseits greift das mechanistische Kausalitätsprinzip zu kurz. Die Annahme des Entwicklungsbaumes heißt demgegenüber: Ursache-Wirkungs-Beziehungen können unmittelbar sein, sie können aber auch immer stärker durch Prozesse der Selbstorganisation vermittelt sein, sie können nämlich reflexiv, darüberhinaus sensibel und schließlich final (zielorientiert, teleologisch) sein. Die Teleologie läßt sich hier als ein Abkömmling der Kausalität begreifen, der bei sozialen Systemen anzutreffen ist, und nicht als eine ganz andere Kategorie, genauso wie die Reiz-Reaktivität, als welche Ursache und Wirkung bei lebenden Systemen erscheinen. Jede Kategorie ist durch eine differentia specifica vom jeweiligen genus proximum ausgezeichnet und bewahrt die abstammungsmäßig ihr vorausliegenden Kategorien in sich auf. Die Besonderung ist das, was ihr Wesen ausmacht. Dementsprechend zerfallen zweitens die selbstorganisierenden Systeme in einfache dissipative und autopoietische und diese wiederum in einfache autopoietische und re-kreative Systeme. Und dementsprechend läßt sich zum dritten die Evolution der Semiose als Prozeß fortschreitender Symmetriebrechungen nachzeichnen, in dem mit der Fähigkeit zur Dissipation der Entropie die Eco-Schwelle (9) hin zu semiotischen Bezügen überschritten wird, die allerdings noch undifferenziert ineinsfallen, und in dem das Auftauchen der Autopoiese den Punkt markiert, an dem sich eine noch vereint semantisch-pragmatische Dimension von einer syntaktischen Dimension absondert, und in dem durch das Aufkommen der Re-Kreation als vorläufig letztem Entwicklungsprodukt der Selbstorganisation sich auch die pragmatische von der semantischen Dimension trennt (siehe Abb. 3.3.2).
Abb. 3.3.2: Logisch-historische Kategorien der Semiose Aufgrund solcher Annahmen können die Generierung und die Strukturierung des Informationsgeschehens in Gestalt von Stufen angeordnet werden (vgl. Fenzl/Hofkirchner 1996) (siehe Abb. 3.3.3). Diese Stufen bedeuten freilich keine lineare, notwendige aufsteigende Folge, als ob die letzte Stufe als Ziel vorgegeben wäre. Der Übergang von einer Stufe zur nächsten vollzieht sich vielmehr in einem Prozeß der Selbstorganisation, in dem die Zukunft nur dadurch von der Vergangenheit bestimmt ist, daß die erstere auf der letzteren aufbauen, vom historisch vorgefundenen Möglichkeitsraum ausgehen muß, nicht aber dadurch, daß es nur eine einzige Möglichkeit zur Fortsetzung des Stufenbaus gäbe. Das Allgemeine und Notwendige verkörpert die Gesamtheit des Möglichkeitsraums als die Basis der Realisation, das Besondere und Zufällige jedoch, das dem realisierten Überbau innewohnt, ist nicht vorwegnehmbar. Der Überbau, obwohl er aus der Basis entsteht, modelt sie gleichwohl um, so daß seine eigene Basis entsteht (10). Während die allgemeine Stufe der Information als Widerspiegelung in der Musterbildung besteht, verwandelt sich das Muster durch die Zuweisung von Bedeutung in ein Symbol, das die neue Grundlage der Bedeutungszuweisung bildet und die Widerspiegelung auf die weniger allgemeine Stufe der Information als Repräsentation hebt, und verwandeln sich weiters die Be-Deutung und Symbolisierung durch die Be-Wertung in die Verfügung über Wissen als Basis der Weisheit und in die Verfügung über Daten als Basis des Wissens auf der Stufe der Information als Entscheidung, die am wenigsten allgemein (nämlich nur einer einzigen Phase von Systemen vorbehalten) ist. Jede Stufe basiert also auf den vorhergehenden, aber in einer eigens zugerichteten Form (was in der Abbildung die Überlappung der Schraffuren anzeigen soll).
Abb. 3.3.3: Die Stufung des Informationsgeschehens Mit einem derartigen Stufenmodell, das die emergenzphilosophisch fundierte Theorie evolutionärer Systeme zum Hintergrund hat, scheint die eingangs gestellte Aufgabe, Information konkret-allgemein auf den Begriff zu bringen, einlösbar. „Konkret-allgemein“ heißt „flexibel, anwendbar auf verschiedene Fälle, anreicherbar mit speziellen Merkmalen, entsprechend der Entwicklung des Objekts selbst, ohne abstrakt und inhaltsleer zu sein“. Mit einem derartigen Stufenmodell scheint es möglich, die Einheit und den Unterschied, das Allgemeine und das Einzelne im Erkenntnisgegenstand Information zu fassen, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. „Information“ muß keine Einheitsformel bedeuten, die schematisch allen Ausprägungen des Informationsgeschehens aufgezwängt wird. „Information“ muß nicht in jeder Erscheinungsform eine eigene, unvergleichbare Bedeutung haben. Und „Information“ muß keine anthropomorphisierende, keine physikalistische oder sonst zwischen diesen Extremen liegende Übertragung der Züge einer Erscheinung auf eine andere bedeuten. „Information“ kann zu einem Begriff werden, der der Sache ihr Recht läßt und trotzdem handhabbar bleibt. Vorstellbar wird die Erarbeitung einer allgemeinen Informationstheorie, die sich den gemeinsamen Zügen allen Informationsgeschehens widmet, wie spezieller Informationstheorien, die auf der Grundlage der ersteren Information in einfachen selbständernden Systemen (das sind eine Teilmenge der physikalischen und chemischen Systeme), Information in einfachen selbstherstellenden Systemen (das sind alle biotischen Systeme) oder Information in selbstschaffenden Systemen (das sind alle sozialen Systeme) zum Untersuchungsgegenstand haben. Eine einheitliche Theorie der Information gerät ins Blickfeld der wissenschaftlichen Anstrengungen. Weil er sich durch die Veränderungsdynamik eines Systems definiert und zwischen dem Prozeß der Erzeugung eines Qualitätssprungs im System und dessen Resultat, dem Sprung selber, der im System seinen Niederschlag findet, unterscheidet, rückt der einheitliche Informationsbegriff einer solchen vereinheitlichten Theorie der Information die in Alltag und Technik noch weit verbreitete dingliche Auffassung von der Information als verkürzt zurecht, beläßt ansonsten aber das Kanalmodell für seinen Bereich in seinem Recht. Gleichzeitig belebt er den antiken Informationsbegriff wieder, wo er an dessen Konnotationen von der Erzeugung von Neuem und von der Selbstformungsfähigkeit der Natur anknüpft.
1 Marx spricht hier von einer realabstraktion. Ihm zufolge ist eine „Theorie“ der Arbeit erst möglich geworden, als die praktischen Bedingungen die Arbeit zu einer Realabstraktion werden lassen haben. D.h. erst als die Arbeit in Wirklichkeit – mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft – zu einer allgemeinen Erscheinung geworden ist, hat sie auch theoretisch auf den Begriff gebracht werden können. 2 Capurro selbst ist der Meinung, daß das Trilemma nicht aufgelöst werden kann. 3 Als einer ihrer wichtigsten Verteter gilt C. Lloyd Morgan (1923). Vgl. die gleichnamige Arbeit von Blitz (1992). 4 Ebeling/Feistel (1994: 25) versuchen mit einer ganz ähnlichen Grafik, die theoretisch formulierte Dialektik von Einschränkung und Erweiterung zu visualisieren. Sie verlegen allerdings die Spitze aller Kegel in einen gemeinsamen Ursprung, was m.E. dahingehend mißverstanden werden kann, daß das Auftreten späterer Entwicklungsprodukte bereits im Big Bang angelegt sei. In meiner Abbildung wird zwischen Möglichkeiten und Wirklichkeit unterschieden: Die Darstellung eines Kegels als Ausschnitt aus einem größeren soll die Einschränkung der Möglichkeiten veranschaulichen, die Darstellung eines Kegels in einer Farbe, die im jeweils zugrundeliegenden Kegel nicht vorkommt, die Erweiterung der Wirklichkeit sinnfällig machen. 5 Der Punkt, den ich hier machen will, ist nicht nur der, daß in systemtheoretischer Sprechweise bei der mechanischen Kausalität nur äußere Ursachen eine Rolle spielen und daher die inneren vernachlässigt werden können. Tatsächlich gibt es eine Tendenz naturwissenschaftlich sozialisierter ForscherInnen, das alte mathematisch-physikalische Weltbild in die Interpretation der Phänomene der Selbstorganisation dadurch herüberzuretten, daß neben den äußeren Ursachen die im System selbst liegenden inneren Ursachen in die Betrachtung mit eingeschlossen werden, diese aber nach Art der bisherigen mechanischen Beziehungen als genauso streng determiniert vorgestellt werden und der Grund für mangelnde Voraussagbarkeit und Berechenbarkeit nicht in der Natur der inneren Beziehungen, sondern in der mangelnden Kenntnis von ihnen, in der Unvollständigkeit des subjektiven Wissens, gesehen wird. Demgegenüber will ich an der andersartigen Beschaffenheit der inneren Ursachen im Fall zur Entwicklung fähiger Systeme festhalten. Sie haben keinen inneren Mechanismus, der sich in lineare Kausalketten zerlegen läßt. Was sie produzieren, ist keine Resultante aufeinander zurückführbarer Verarbeitungsschritte. Produktivität heißt bei ihnen Kreativität, indem sie Spielräume nutzen können, in denen nicht alles festgelegt ist. Im übrigen macht es auch durchaus Sinn, die nicht-mechanischen, freieren Kausalbeziehungen als innere Ursachen in die Systeme zu verlegen und sie nicht als Zufall außen vor zu lassen. So wird verständlich, wie Systeme ein Selbst und Subjektcharakter entwickeln konnten. Im Lauf der Evolution zeigen die Systeme einen wachsenden Freiraum für das Hervorbringen von Neuem. 6 Die Wahl dieses Terminus verdanke ich den Diskussionen mit Norbert Fenzl und Gottfried Stockinger, die wir im Rahmen des Projektes „Zur Genese von Informationsstrukturen“ geführt haben. 7 Nicht zuletzt hierin – im Auseinanderfallen von Darstellung der Notwendigkeit der Systemreproduktion und Entscheidung über die Verfolgung von Zielen, in der Kluft zwischen Sein und Wollen – liegt die Möglichkeit begründet, daß in sozialen Systemen das Überleben selbst in Frage gestellt wird. 8 Nach dem bekannten Semiotiker Umberto Eco ist diejenige Schwelle benannt, jenseits welcher von keinen Zeichen mehr die Rede sein kann. 9 Insofern ist das hier vorgestellte Stufenmodell gleichbedeutend mit einem Spiralmodell, das vom Durchlaufen einer Wegstrecke auf höherem Niveau spricht. 10 Die sogenannte Informationsverarbeitung in technischen Systemen gewinnt durch diese Sichtweise einen anderen Stellenwert. Technische Systeme sind künstlicher Teil sozialer Systeme und Hilfsmittel im sozialen Informationsgeschehen. Sie dienen dazu, in den verschiedenen Schichten des je bestimmten sozialen Systems dessen Datensammlung oder dessen Wissensbasis oder dessen Entscheidungsfindung zu rationalisieren, zu ökonomisieren, zu effektivieren, tragen also zu einer Beschleunigung der Prozesse bei, auf denen die Metamorphose der Information des sozialen Subjekts beruht, können aber nicht aus sich heraus Information im Sinne der Emergenz von Neuem generieren, da sie nicht wie die natürlichen realweltlichen Systeme Subjekt des Informationsgeschehens sind. Eine Theorie der künstlichen Informationsverarbeitung müßte diese Überlegungen zu ihrem Ausgangspunkt machen.
Ayres, R. U.: Information, Entropy, and Progress, AIP, New York 1994. Bar-Hillel, Y./Carnap, R.: Semantic Information; in: Brit. J. Phil. Science 4, 147-157, 1953. Bertalanffy, L. v.: General System Theory, Braziller, New York 1968. Blaseio, H.: Das Kognos-Prinzip, Zur Dynamik sich-selbst-organisierender wirtschaftlicher und sozialer Systeme, Duncker&Humblot, Berlin 1986. Blitz, D.: Emergent evolution: qualitative novelty and the levels of reality, Kluwer, Dordrecht 1992. Bauer, L./ Matis, L. (Hg.): Evolution – Organisation – Management. Zur Entwicklung und Selbststeuerung komplexer Systeme, Duncker&Humblot, Berlin 1989. Capurro, R.: Information. Ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen Begründung des Informationsbegriffs, Saur, München u.a. 1978. Capurro, R.: Leben im Informationszeitalter, Akademie-Verlag, Berlin 1995. Ebeling. W./ Feistel, R.: Chaos und Kosmos – Prinzipien der Evolution, Spektrum, Heidelberg 1994. Eigen, M. et al.: Ursprung der genetischen Information; in: Spektrum der Wissenschaft 6, 37-66, 1985. Fenzl, N. et al.: On the Genesis of Information Structures; in: Kornwachs/Jacoby, 271-283, 1996. Fenzl, N./Hofkirchner, W.: Information Processing in Evolutionary Systems. An Outline Conceptual Framework for a Unified Information Theory; in: Schweitzer, F. (Ed.), Self-Organization of Complex Structures, From Individual to Collective Dynamics, vol. I, Gordon and Breach, London 1996. Fleissner, P./Hofkirchner, W.: In-formatio revisited. Wider den dinglichen Informationsbegriff; in: Informatik Forum 3, 126-131, 1995. Fleissner, P./Hofkirchner, W.: Emergent Information. Towards a Unified Information Theory; in: BioSystems 38, 243-248, 1996. Fleissner, P./Hofkirchner, W.: Actio non est reactio. An extension of the concept of causality towards phenomena of information; in: World Futures 49 (forthcoming), 1997. Foerster, H. v./Zopf, G. W. Jr. (Eds.): Principles of Self-Organization, Pergamon, New York 1962. Gernert, D.: Pragmatic Information as a Unifying Concept; in: Kornwachs/Jacoby, 147-162, 1996. Goerner, S. J.: Chaos and the Evolving Ecological Universe, Gordon&Breach, Amsterdam etc. 1994. Haken, H./Wunderlin, A.: Die Selbststrukturierung der Materie, Vieweg, Braunschweig 1991. Heylighen, F.: Autonomy and Cognition as the Maintenance and Processing of Distinctions; in: Heylighen, F./Rosseel, E./a. Demeyere, F. (Eds.), Self-Steering and Cognition in Complex Systems, Toward a New Cybernetics, 89-106, Gordon and Breach, New York etc. 1990. Holling, C. S.: Resilience and Stability of Ecological Systems; in: Annual Review of Ecology and Systematics 4, 1-23, 1973. Hörz, H.: Materiestruktur, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1971. Jantsch, E.: Erkenntnistheoretische Aspekte der Selbstorganisation natürlicher Systeme; in: Schmidt, S. J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, 159-191, Suhrkamp, Frankfurt 1987. Kanitscheider, B.: Von der mechanistischen Welt zum kreativen Universum – Zu einem neuen philosophischen Verständnis der Natur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1993. Kornwachs, K./Jacoby, K. (Eds.): Information. New Questions to a Multidisciplinary Concept, Akademie Verlag, Berlin 1996. Kornwachs, K.: System as Information – Information as System; in: World Futures 49 (im Druck) 1997. Laszlo, E.: Introduction to Systems Philosophy. Toward a New Paradigm of Contemporary Thought, Gordon and Breach, New York etc. 1972a. Laszlo, E.: The Systems View of the World, Braziller, New York 1972b. Laszlo, E./v. Liechtenstein, A.: Evolutionäres Management. Globale Handlungskonzepte, Paidia Verlag, Fulda 1992. Lighthill, J.: The Recently Recognized Failure of Predictability in Newtonian Dynamics; in: Proc. R. Soc. A 407, 38, London 1986. Lorenz, E. N.: Deterministic Nonperiodic Flow; in: Jour. Atmospheric Sciences 20, 69, 1976. Luhmann, N.: Soziale Systeme, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984. Mainzer; K.: Thinking in Complextiy. The Complex Dynamics of Matter, Mind, and Mankind, Springer, Berlin etc. 1994. Mandelbrot, B.: The Fractal Geometry of Nature, San Francisco 1982. Mannermaa, M.: In Search of an Evolutionary Paradigm for Futures Research; in: Futures 4/, 349–372, 1991. Maturana, H. K./Varela, F. J.: Der Baum der Erkenntnis, Scherz, Bern/München/Wien 1987. Prigogine, I./Stengers, I.: Das Paradox der Zeit, Piper, München/Zürich 1993. Sandvoss, E. R.: Philosophie im globalen Zeitalter, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994. Warnecke, H.-J.: Die Fraktale Fabrik. Revolution der Unternehmenskultur, Springer, Berlin 1992. |